 Im August erschien eine Neuauflage des Buches Gelassen durch die Trotzphase von Annette Kast-Zahn. Frau Kast-Zahn erlangte (traurige) Berühmtheit als Autorin des wohl am meisten gehassten Erziehungsratgebers Jedes Kind kann schlafen lernen, in dem geraten wird, dass nicht allein einschlafende oder nicht durchschlafende Kinder durch gezieltes Schreien lassen bis zur Resignation frustriert werden. Ich war außerordentlich neugierig, was Frau Kast-Zahn in Bezug auf die Trotzphase empfiehlt. Der GU-Verlag hat mir freundlicherweise (und wahrscheinlich auch das letzte Mal) ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, so dass ich meine Neugier befriedigen konnte. Leider war mir eine sachliche Rezension nicht möglich - Euch erwartet vielmehr eine kritische Auseinandersetzung.
Im August erschien eine Neuauflage des Buches Gelassen durch die Trotzphase von Annette Kast-Zahn. Frau Kast-Zahn erlangte (traurige) Berühmtheit als Autorin des wohl am meisten gehassten Erziehungsratgebers Jedes Kind kann schlafen lernen, in dem geraten wird, dass nicht allein einschlafende oder nicht durchschlafende Kinder durch gezieltes Schreien lassen bis zur Resignation frustriert werden. Ich war außerordentlich neugierig, was Frau Kast-Zahn in Bezug auf die Trotzphase empfiehlt. Der GU-Verlag hat mir freundlicherweise (und wahrscheinlich auch das letzte Mal) ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, so dass ich meine Neugier befriedigen konnte. Leider war mir eine sachliche Rezension nicht möglich - Euch erwartet vielmehr eine kritische Auseinandersetzung. Das Buch
Das Buch ist unterteilt in Theorie- und Praxisteil. Im Theorieteil geht es zunächst um die Meilensteine der Entwicklung. Es wird kurz darauf eingegangen, dass sich Kinder in der Trotzphase (wie die Autonomiephase durchgehend genannt wird) oft sprachlich nicht ausreichend ausdrücken können und die Wut daher anders ausgedrückt werden muss. Mit der Entdeckung des eigenen "Ich" beginnt zudem eine Phase, in der Kinder immer wieder ausprobieren, welche Folgen ihre Handlungen haben. Erst wenn das Kind in der Lage ist, sich in andere einzufühlen, wird es unerwünschte Handlungen aufgrund von Einsicht unterlassen.
Unter der Überschrift "Die Kunst, dem Kind zu geben, was es braucht", wird die Wichtigkeit liebevoller Zuwendung als außerordentlich wichtig hervorgehoben. Um die Wichtigkeit zu unterstreichen gibt es den etwas seltsam anmutenden Tipp:
"Jeden Tag braucht ihr Kind mindestens einmal Ihre ungeteilte positive Aufmerksamkeit".
Ich weiß nicht, wie es Euch geht - meine Kinder brauchen durchaus eher öfter und nicht nur "einmal am Tag"ungeteilte Aufmerksamkeit - vor allem in der Autonomiephase. Zwar steht da "mindestens einmal" - aber die Formulierung suggeriert dennoch, dass (nur) "einmal" auch völlig in Ordnung wäre.
Anschließend wird erklärt, dass auch Verlässlichkeit, Schutz, Gelegenheiten zum Lernen und Spielen sowie "starke Eltern" das sind , was sich Kinder wünschen. Und Eltern, die Grenzen setzen, wenn das Kind etwas möchte, das ihm nicht gut tut. Was Kindern "nicht gut tut", wird sogleich näher erläutert: Gefährliches, Unangemessenes und Unsinniges (bspw. so vermessen zu sein, statt des blauen Bechers lieber den roten und danach dann doch den gelben haben zu wollen). Eltern müssten unbedingt Regeln aufstellen und durchsetzen. Um das genauer zu erläutern, beschreibt Frau Kast-Zahn zwei "Trotzkisten" - die "Ich will - aber ich darf nicht"-Kiste und die "Ich muss - aber ich will nicht"-Kiste. Ein etwas schwurbeliges Konzept, das umständlich erklärt, warum Kinder üblicherweise trotzen - wenn sie etwas nicht dürfen oder etwas tun müssen, worauf sie keine Lust haben
Es gibt aus Sicht der Autorin grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten, mit einem Wutanfall umzugehen: den Anfall persönlich zu nehmen, selbst laut zu werden, zu schreien, zu schimpfen und dem Kind Vorwürfe zu machen. Das sei jedoch nicht sinnvoll, (nicht etwa, weil es entwürdigend und respektlos sei, sondern) weil das Kind dabei lerne, dass Schreien und Schimpfen in Ordnung sind.
Die andere (und damit vermeintlich einzig richtige) Möglichkeit ist, den Anfall nicht persönlich zu nehmen, ruhig und gelassen zu bleiben, aber unbedingt darauf zu bestehen, dass das Kind trotzdem tun muss was es soll oder nicht tun darf, was es will. Das ermögliche dem Kind wichtige Erfahrungen, die für seine Entwicklung hilfreich seien. So lernt es nach und nach, bestimmte Regeln und Pflichten zu akzeptieren. Belohnt man Trotzanfälle nicht mit Aufmerksamkeit, würden sie von allein immer seltener.
Generationen von Eltern können bestätigen können, dass das Ignorieren von Wutanfällen ganz sicher nicht dazu führt, dass Kinder seltener welche haben - sie werden vielmehr noch lauter und noch wütender - und selbst wenn sie aufhören zu weinen, dann doch nur aus Verzweiflung, weil ihnen ohnehin keiner zuhört oder sich gar vorsätzlich abwendet. Offenbar hat Frau Kast-Zahn ein pädagogisches Patent-Konzept für alle Lebenslagen: Man muss Kinder einfach nur bis zur Resignation ignorieren - dann werden sie ihr Verhalten schon wunschgemäß anpassen.
Das war es dann auch schon zur Theorie - den Abschluss dieses Buchteils bilden zwei Test, bei denen ich meinen Augen kaum traute. In fünf verschiedenen Bereichen soll man sein Kind einschätzen. Es werden verschiedene Sachverhalte aufgezählt - macht das Kind etwas gar nicht, dann gibt es 0 Punkte, macht es etwas sehr oft, gibt es 3 Punkte. Hier ein Auszug aus den Fragen:
Mein Kind:
Anschließend wird erklärt, dass auch Verlässlichkeit, Schutz, Gelegenheiten zum Lernen und Spielen sowie "starke Eltern" das sind , was sich Kinder wünschen. Und Eltern, die Grenzen setzen, wenn das Kind etwas möchte, das ihm nicht gut tut. Was Kindern "nicht gut tut", wird sogleich näher erläutert: Gefährliches, Unangemessenes und Unsinniges (bspw. so vermessen zu sein, statt des blauen Bechers lieber den roten und danach dann doch den gelben haben zu wollen). Eltern müssten unbedingt Regeln aufstellen und durchsetzen. Um das genauer zu erläutern, beschreibt Frau Kast-Zahn zwei "Trotzkisten" - die "Ich will - aber ich darf nicht"-Kiste und die "Ich muss - aber ich will nicht"-Kiste. Ein etwas schwurbeliges Konzept, das umständlich erklärt, warum Kinder üblicherweise trotzen - wenn sie etwas nicht dürfen oder etwas tun müssen, worauf sie keine Lust haben
Es gibt aus Sicht der Autorin grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten, mit einem Wutanfall umzugehen: den Anfall persönlich zu nehmen, selbst laut zu werden, zu schreien, zu schimpfen und dem Kind Vorwürfe zu machen. Das sei jedoch nicht sinnvoll, (nicht etwa, weil es entwürdigend und respektlos sei, sondern) weil das Kind dabei lerne, dass Schreien und Schimpfen in Ordnung sind.
Die andere (und damit vermeintlich einzig richtige) Möglichkeit ist, den Anfall nicht persönlich zu nehmen, ruhig und gelassen zu bleiben, aber unbedingt darauf zu bestehen, dass das Kind trotzdem tun muss was es soll oder nicht tun darf, was es will. Das ermögliche dem Kind wichtige Erfahrungen, die für seine Entwicklung hilfreich seien. So lernt es nach und nach, bestimmte Regeln und Pflichten zu akzeptieren. Belohnt man Trotzanfälle nicht mit Aufmerksamkeit, würden sie von allein immer seltener.
Generationen von Eltern können bestätigen können, dass das Ignorieren von Wutanfällen ganz sicher nicht dazu führt, dass Kinder seltener welche haben - sie werden vielmehr noch lauter und noch wütender - und selbst wenn sie aufhören zu weinen, dann doch nur aus Verzweiflung, weil ihnen ohnehin keiner zuhört oder sich gar vorsätzlich abwendet. Offenbar hat Frau Kast-Zahn ein pädagogisches Patent-Konzept für alle Lebenslagen: Man muss Kinder einfach nur bis zur Resignation ignorieren - dann werden sie ihr Verhalten schon wunschgemäß anpassen.
Das war es dann auch schon zur Theorie - den Abschluss dieses Buchteils bilden zwei Test, bei denen ich meinen Augen kaum traute. In fünf verschiedenen Bereichen soll man sein Kind einschätzen. Es werden verschiedene Sachverhalte aufgezählt - macht das Kind etwas gar nicht, dann gibt es 0 Punkte, macht es etwas sehr oft, gibt es 3 Punkte. Hier ein Auszug aus den Fragen:
Mein Kind:
- wirkt beim Spielen zufrieden und freut sich über Erfolge
- erzählt bereitwillig von seinen Erlebnissen
- kann in aller Ruhe stiller Beschäftigung nachgehen
- nimmt mit Kindern oder außerhalb der Familie Blickkontakt auf
- kann ein Nein akzeptieren
- kann warten ohne zu quengeln
- erledigt Pflichten zügig und ohne zu trödeln
- folgt bereitwillig den Anweisungen der Eltern
- schläft ohne Probleme ein
- bleibt beim Essen sitzen
- akzeptiert das, was auf den Tisch kommt, ohne zu jammern
 Der Fragebogen soll dazu dienen, die positive Entwicklung des Kindes zu zeigen und "Ecken und Kanten im Verhalten" zu bestimmen. Wenn ich den Bogen für meinen dreijährigen Sohn ausfüllen müsste, würde ich wahrscheinlich geschockt sein, welche eklatante Schwächen mein Kind hat. Natürlich meckert er, wenn es abends wieder mal Brot gibt oder er Erbsen auf seinem Teller findet. Warten findet er total blöd, auf meine Frage, wie es in der Kita war, bekomme ich die Standardantwort "Schön!" und bereitwillig, zügig und ohne zu trödeln "folgt" er nur dann, wenn er eigene Interessen verfolgt. Vom allein Einschlafen träume ich seit knapp vier Jahren. Dennoch halte ich mein Kind nach wie vor für vollkommen normal entwickelt und finde es altersgerecht, wenn ein Kind in der Trotzphase eben nicht bereitwillig den Anweisungen der Eltern folgt oder bei seinen Verrichtungen trödelt.
Der Fragebogen soll dazu dienen, die positive Entwicklung des Kindes zu zeigen und "Ecken und Kanten im Verhalten" zu bestimmen. Wenn ich den Bogen für meinen dreijährigen Sohn ausfüllen müsste, würde ich wahrscheinlich geschockt sein, welche eklatante Schwächen mein Kind hat. Natürlich meckert er, wenn es abends wieder mal Brot gibt oder er Erbsen auf seinem Teller findet. Warten findet er total blöd, auf meine Frage, wie es in der Kita war, bekomme ich die Standardantwort "Schön!" und bereitwillig, zügig und ohne zu trödeln "folgt" er nur dann, wenn er eigene Interessen verfolgt. Vom allein Einschlafen träume ich seit knapp vier Jahren. Dennoch halte ich mein Kind nach wie vor für vollkommen normal entwickelt und finde es altersgerecht, wenn ein Kind in der Trotzphase eben nicht bereitwillig den Anweisungen der Eltern folgt oder bei seinen Verrichtungen trödelt.Die Auswertung des Tests ist dann auch noch vollkommen nichtssagend - wenn das Kind wenige Punkte bei "sozialem Verhalten" hat, soll man sein Kind bei positivem Verhalten Aufmerksamkeit schenken (warum das nicht sinnvoll ist, darüber habe ich im Artikel über das Loben ausführlich geschrieben). Hat es einen Mangel an Selbstvertrauen, soll man mit dem Kindergarten sprechen (warum, bleibt unklar). Bezüglich Schlafen/Essen/Sauberwerden heißt es lapidar "Erzwingen können Sie hier gar nichts". Ganz genau - warum soll ich also diese "Schwächenanalyse"überhaupt machen? Zurück bleibt allein ein vermeintliches Ideal-Bild vom folgsam angepassten Kind...
Der zweite Test testet meine Erziehungskompetenz. Vorab erfahre ich: bei den Themengebieten "Konsequent handeln" und "Klartext reden" bekomme ich meine Punkte nur, wenn ich freundlich und sachlich bin und meine Konsequenzen fair und durchdacht sind. Besonders viele Punkte für Erziehungskompetenz bekomme ich, wenn ich mein Kind höchstens drei mal ermahne, bevor ich eine Konsequenz folgen lasse. Oder wenn ich wenig rede, wenn ich eine Grenze setze. Oder wenn ich fest bleibe, wenn mein Kind mit mir Verbote oder Anweisungen diskutieren will. Ich muss auch sofort reagieren, wenn mein Kind sich unangemessen verhält.
Ich rätsele noch immer etwas, worin der Unterschied zwischen den folgenden Punkten besteht:
- "Wenn mein Kind sich unangemessen verhält, reagiere ich sofort"
- "Eine angekündigte Konsequenz setze ich auch in die Tat um" und
- "Wenn mein Kind meinen Aufforderungen nicht nachkommt, lasse ich Taten folgen"
Eins ist für Frau Kast-Zahn jedoch definitiv klar: Wenn ich nicht klare Ansagen mache und sofort und absolut unnachgiebig mit strengen Konsequenzen agiere, versage ich erzieherisch total und muss mich nicht über mein trotzdendes Kleinkind wundern. Aus Sicht der Autorin ist es natürlich unbedingt erforderlich, zu 100 % konsequent zu sein, denn das ist absolut unumgänglich, wenn man eine komplette Resignation sicher stellen möchte. Das Kind muss das Gefühl haben, absolut keine Chance zu haben, also völlig machtlos und ausgeliefert zu sein - dann wird es schon tun, was man von ihm verlangt.
Mich hat dieser Erziehungsfragebogen sehr wütend gemacht - suggeriert er doch, dass besondere Strenge erforderlich sei, um erziehungskompetent durch die Trotzphase zu kommen. Dabei sind viel mehr Geduld, Empathie und Zuwendung erforderlich, um Kinder liebevoll zu begleiten. Ich habe die Erfahrung gemacht: Geht man auf Kinder liebevoll ein und handelt man Kompromisse aus, dann trotzen sie deutlich weniger, als wenn ich eiskalt konsequent bin und sie ignoriere.
Der Trotz-Praxis-Teil unterscheidet nachfolgend in Trotz
- aus Wut und Willensstärke,
- aus Angst und
- beim Schlafen, Essen und Sauberwerden.
Zunächst wird Trotz bei Kindern unter 3 Jahren thematisiert. Frau Kast-Zahn stellt zutreffend fest, dass die Trotzneigung sowohl typabhängig, als auch normal ist. Allerdings seien viele Eltern selbst Schuld an ausgeprägterem Trotzverhalten. Durch "vorbeugende Anpassung" würden sich Eltern dabei nämlich so verhalten, dass sie Dinge vermeiden, die Kinder wütend machen. Dabei würden Kinder jedoch lernen, dass sich die Welt vermeintlich nur um sie drehe und wenn dann mal etwas nicht nach ihrem Willen läuft, würden sie umso schlimmer trotzen. Ebenso schlimm sei es, während eines Trotzanfalls nachzugeben und unsinnige Wünsche zu erfüllen. Denn dadurch würden Kinder lernen, dass sie alles bekämen, was sie wollen.
Ich kann nicht erkennen, inwiefern es schädlich sein soll, trotzauslösende Reaktionen zu vermeiden. Eine außer Reichweite gestellte Klobürste oder ein "Ja!" zu einem Wunsch, bei dem man die Frage "Warum nicht?" nicht beantworten kann, haben schon manchen Wutausbruch verhindert. Dabei lernen Kinder nicht, dass sich die Welt um sie dreht, sondern dass sie von Erwachsenen umgeben sind, die sie gleichwertig behandeln, ihre Bedürfnisse ernst nehmen und versuchen, Kompromisse einzugehen. Es gibt schließlich noch genügend andere Gelegenheiten, bei denen wir "Nein!" sagen müssen.
Frau Kast-Zahn empfiehlt jedoch, dass man Trotzanfälle grundsätzlich aushalten muss und keinesfalls dem Willen nachgeben darf. Wichtig sei, den Anfall gelassen hinzunehmen und ihn nicht persönlich zu nehmen (wogegen nichts einzuwenden ist) - falls die Situation zu kippen droht, dann könne man eine Auszeit verordnen. Für Kinder unter drei Jahren wird empfohlen, entweder in eine andere Ecke des Raums zu gehen und das Kind zu ignorieren oder wortlos aus dem Raum zu gehen, bzw. zu sagen "Wenn du dich beruhigt hast, komme ich wieder". Schreit das Kind länger, schlägt sie "bewährte Methoden" vor: man könne alle zwei Minuten zum Kind gehen und fragen: "Kann ich dir helfen? Ist alles in Ordnung?" (Natürlich nicht - sonst würde das Kind doch nicht schreien!) Schreit es dann dennoch ganz unbeeindruckt weiter, geht man eben wieder. Nur, wenn es einem schluchzend die Arme entgegenstreckt, dann bleibt man und tröstet es.
Für die Auszeit gibt es noch Tipps:
"Wenn Ihr Kind schreiend hinter Ihnen herläuft oder sich an sie klammert, verwenden Sie möglichst ein Türgitter, um für den Abstand zu sorgen. Als Ausnahme kommt auch der Laufstall oder das Gitterbettchen in Frage. Gehen Sie dann immer wieder in kurzen Abständen zu Ihrem Kind und machen ihm klar dass die Auszeit sofort beendet ist, wenn es aufhört zu schreien: "Wenn du nicht mehr so laut weinst, kannst du wieder zu mir kommen". Wenn Ihr Kind sich beruhigt hat, ist ein kurzes Versöhnungsritual hilfreich: Nehmen Sie es in den Arm und sagen Sie etwas Aufmunterndes: "Jetzt ist alles wieder gut. Da bin ich aber froh" (S. 44).
Ich weiß nicht, wie es Euch geht - mir brechen diese Worte wirklich das Herz - das ist einfach nur unmenschlich und grausam. Wie kann man ernsthaft vorschlagen, Wutanfälle bloß nicht mit Aufmerksamkeit zu belohnen? Aber es geht noch weiter: wenn das Kind mit dem Kopf auf den Boden schlägt, empfiehlt die Autorin, man solle freundlich und sachlich bleiben und dann eine Auszeit verhängen. Frau Kast-Zahn hat dazu dann gleich noch einen weiteren Tipp: sobald sich ein Wutanfall bei Kopf-auf-den-Boden-hau-Kindern anbahnt, wird ihnen einfach ein Fahrradhelm aufgesetzt! Problem gelöst.
Und was ist, wenn sich das Kind vor Wut wegschreit (respiratorischer Affektkrampf)? Auch dem solle man bloß nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken - man soll in der Nähe bleiben (immerhin!), das Kind beobachten und nach dem Anfall einfach sachlich-freundlich zur Tagesordnung übergehen. Während des Anfalls kann man sich wiederholt sagen: "Es sieht schlimm aus. Aber es ist nicht schlimm". Und man solle bloß nicht durch "vorbeugendes Anpassen" das Wegschreien verhindern wollen - je mehr Wünsche wir von den Augen ablesen würden, desto mehr ist unser Kind frustriert, wenn wir mal nicht den Wunsch richtig erraten. Denn - ganz wichtig! - das Kind lernt so ja auch nur wieder, dass es durch Affektkrämpfe etwas "Angenehmes" (?!) erreicht und damit steigt dann die Häufigkeit der Wutanfälle. Welch abgrundtief gemeines Bild von Kindern hier gezeichnet wird! Die kleinen, verschlagenen Satansbraten, die uns durch ihre Garstigkeit in den Wahnsinn treiben wollen und nicht mal davor zurück schrecken, einen Affektkrampf willentlich herbeizuführen (was zwar nicht möglich ist - aber egal) - das Kind hat ganz sicher grundsätzlich böse Absichten! Mit unter drei Jahren!
Bei älteren Kindern wird es dann für uns Eltern deutlich schwieriger, schließlich können Kinder uns nun bewusst ärgern, beleidigen, sich widersetzen, stur stellen, alles verweigern. Da gilt es dann, noch stärkere Geschütze aufzufahren. Zunächst erst mal soll man nicht lange diskutieren oder erklären. Und natürlich wieder: auf keinen Fall nachgeben! Es gilt standhaft zu bleiben! Umso seltsamer mutet dann plötzlich der Tipp mitten im Text an:
Und was ist, wenn sich das Kind vor Wut wegschreit (respiratorischer Affektkrampf)? Auch dem solle man bloß nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken - man soll in der Nähe bleiben (immerhin!), das Kind beobachten und nach dem Anfall einfach sachlich-freundlich zur Tagesordnung übergehen. Während des Anfalls kann man sich wiederholt sagen: "Es sieht schlimm aus. Aber es ist nicht schlimm". Und man solle bloß nicht durch "vorbeugendes Anpassen" das Wegschreien verhindern wollen - je mehr Wünsche wir von den Augen ablesen würden, desto mehr ist unser Kind frustriert, wenn wir mal nicht den Wunsch richtig erraten. Denn - ganz wichtig! - das Kind lernt so ja auch nur wieder, dass es durch Affektkrämpfe etwas "Angenehmes" (?!) erreicht und damit steigt dann die Häufigkeit der Wutanfälle. Welch abgrundtief gemeines Bild von Kindern hier gezeichnet wird! Die kleinen, verschlagenen Satansbraten, die uns durch ihre Garstigkeit in den Wahnsinn treiben wollen und nicht mal davor zurück schrecken, einen Affektkrampf willentlich herbeizuführen (was zwar nicht möglich ist - aber egal) - das Kind hat ganz sicher grundsätzlich böse Absichten! Mit unter drei Jahren!
Bei älteren Kindern wird es dann für uns Eltern deutlich schwieriger, schließlich können Kinder uns nun bewusst ärgern, beleidigen, sich widersetzen, stur stellen, alles verweigern. Da gilt es dann, noch stärkere Geschütze aufzufahren. Zunächst erst mal soll man nicht lange diskutieren oder erklären. Und natürlich wieder: auf keinen Fall nachgeben! Es gilt standhaft zu bleiben! Umso seltsamer mutet dann plötzlich der Tipp mitten im Text an:
"Damit Ihr Kind Sie und andere mit Respekt behandelt, müssen Sie ihm diese Haltung vorleben. Das bedeutet im Erziehungsalltag konsequent auf den Einsatz von Macht, Willkür und körperlicher Gewalt zu verzichten" (S. 51).
Ja! Ja! Ja! Ganz genau! Nur warum geht es im restlichen Buch nur darum, wie man die elterliche Macht möglichst effektiv einsetzt. Schon auf der nächsten Seite heißt es bspw.:
"Je friedfertiger Ihr Kind ist, desto häufiger wird es gute Lösungen finden. Je kampfbereiter es ist, desto häufiger müssen Sie am Ende konsequent handeln. [...] Wenn es friedlich und bereit zur Zusammenarbeit ist, hat es Vorteile. Wenn es lieber weiterkämpft, muss es mit den Konsequenzen leben" (S. 52).
 Man soll also seine Macht nicht missbrauchen, aber spurt das Kind nicht, dann werden Konsequenzen verhängt. Nur wenn es "friedlich" ist, hat es Vorteile - Zuckerbrot und Peitsche. Findet ein Kind in einem aufgebrachten Wutanfall keine Lösung - Ihr ahnt es - wird eine Auszeit vorgeschlagen. Aber die soll immer freundlich und gelassen verhängt werden - sonst habe das Kind das Gefühl, bestraft zu werden (wie kann man so etwas schreiben und nicht sofort den Widersinn erkennen?)
Man soll also seine Macht nicht missbrauchen, aber spurt das Kind nicht, dann werden Konsequenzen verhängt. Nur wenn es "friedlich" ist, hat es Vorteile - Zuckerbrot und Peitsche. Findet ein Kind in einem aufgebrachten Wutanfall keine Lösung - Ihr ahnt es - wird eine Auszeit vorgeschlagen. Aber die soll immer freundlich und gelassen verhängt werden - sonst habe das Kind das Gefühl, bestraft zu werden (wie kann man so etwas schreiben und nicht sofort den Widersinn erkennen?)Bei der Auszeit gelten dann für die größeren Kinder modifizierte Regeln: sie müssen in einen anderen Raum. Die Tür wird geschlossen und bei Bedarf zugehalten [tatsächlich!]. Eine Minute pro Lebensjahr reicht dabei. Dann macht man ein Friedensangebot. Schreit das Kind danach immer noch, dann wird die Auszeit um ein bis zwei Minuten verlängert und anschließend wieder ein Friedensangebot gemacht [ich würde das jetzt eher Drohung nennen]: "Ist es wieder gut oder muss ich noch mal die Tür zu machen?" Wenn man unterwegs ist, kann man die Auszeit durchführen, indem man z. B. einfach fünf Minuten Zeitung liest und das Kind ignoriert. Aber auch eine Kundentoilette im Kaufhaus kommt dafür in Frage.
Natürlich werden auch logische Konsequenzen empfohlen (die nichts anderes sind, als Strafen) und Belohnungen vorgeschlagen. Zeigt das Kind das erwünschte Verhalten, kann es Belohnungen verdienen. Sollte das nicht ausreichen, um das Kind trotzfrei zu bekommen, gibt es weitere Tipps:
"Schnell reagieren - Bei impulsiven Kindern kommt man ohne Auszeiten nicht klar, ihre heftigen Reaktionen erfordern eine zügige und wirksame Konsequenz" (S. 61).
Aha, wenn Auszeiten nicht helfen, dann soll man also noch mehr Auszeiten verhängen und noch mehr Konsequenzen. Aber auch Rollenspiele könnten helfen.
Und welche Tipps hat Frau Kast-Zahn für Kinder, die Hauen und Beißen? Ist das Kind unter drei, dann soll man mal wieder konsequent sein:
"Bei aller Gelassenheit sollten Sie das unangemessene Verhalten aber sofort beenden, wenn Ihr Kind jemanden schubst, haut, tritt oder beißt. Gehen Sie mit ihm vor die Tür. Setzen Sie eine Auszeit ein."
Ist das Kind älter als drei Jahre, dann sollte das Verhalten verschwunden sein. Wenn nicht, dann ist ganz klar:
"Alles, was Sie zum Thema Trotz [...] gelesen haben, gehört auch beim Umgang mit aggressivem Verhalten zum Handwerkszeug. Insbesondere die Auszeit ist ein wichtiges Mittel: Mit ihrer Hilfe können Sie das unerwünschte Verhalten sofort beenden" (S. 70).
Aber auch Rollenspiele könnten helfen. Und das (natürlich) konsequente Belohnen mit Aufmerksamkeit für friedliches Verhalten. Das Buch bietet in den Umschlagseiten eine Vorlage für einen Belohnungsplan. Viel Loben soll man das Kind natürlich auch unbedingt! Frau Kast-Zahns Tipp für eine effektive positive Wahrnehmung: morgens 10 Büroklammern in die rechte Hosentasche stecken und für jede Aufmerksamkeit für friedliches Verhalten wandert eine Klammer in die andere Tasche. Am Abend sollte die rechte Tasche dann leer sein.
Sie hat auch gleich ein paar Formulierungs-Vorschläge für die positive Wahrnehmung:
Das kann doch nicht wirklich ihr Ernst sein?"Es macht richtig Spaß, dir beim Legospielen zuzuschauen!""Niemand hat so tolle Ideen wie du!""Dein Gedächtnis ist echt eine Wucht!""Du siehst super aus mit deinem neuen T-Shirt!
Ein weiteres Kapitel des Buches beschäftigt sich mit Geschwisterstreitigkeiten. Es gibt ein paar allgemeine Tipps, wie man dem älteren Kind die Entthronung erleichtern kann. Erwartungsgemäß geht es über die üblichen Tipps (wie bereiten Sie das Kind vor, verlangen Sie kein vernünftiges Verhalten, lassen Sie das Kind helfen und nehmen Sie sich Zeit für das Kind) nicht hinaus.
Die Lösung für Geschwisterstreits wird mit "faire Lösungen finden" präsentiert. An sich keine schlechte Idee - aber die praktische Umsetzung lässt einen doch wieder den Kopf schütteln. Hier ein möglicher Vorschlag für den Streit um einen Hüpfball:
"Mutter (bezieht Kinder ein): "So ihr beiden, jetzt ist Schluss mit der Streiterei. Das kriegt ihr friedlich hin, da bin ich ganz sicher. Muss ich euch erst mal zum Abkühlen jeden ins ein Zimmer schicken [ah! Allheilmittel Auszeit androhen] - oder überlegen wir sofort, wie es klappen könnte?"Luise und Lukas: "Nein! Nicht ins Zimmer! Lieber überlegen!"[... Streitgespräch...]Mutter (ermuntert die Kinder zu einem Vorschlag): "So kommen wir nicht weiter. Fällt Euch noch etwas Besseres ein?"Luise: "Erst bin ich eine Stunde dran, dann Lukas. Du guckst auf die Uhr".Mutter (nimmt den Vorschlag auf): "Das ist eine gute Idee. Aber eine Stunde ist zu lang."
Wenn eine Einigung nicht gelingt, kann die Mutter Lukas und Luise zu einer kurzen Auszeit [natürlich] in zwei verschiedene Zimmer schicken und ihnen dann noch einmal gemeinsam eine Chance geben. Klappt es wieder nicht, wird der Hüpfball für den Rest des Tages aus dem Verkehr gezogen. So einfach ist das. Und so schwer".
Drohungen, konsequente Strafandrohung und Auszeiten - mehr bietet Frau Kast-Zahn nicht zur Problemlösung.
Im Kapitel "Trotz aus Angst" geht es um kindliche Ängste - allen voran die Trennungsangst (die übrigens vor allem durch die von der Autorin empfohlene Ferber-Methode verursacht wird). Man muss aber zugestehen, dass dieser Teil des Buches recht gut erklärt, warum Kinder vor allem im Alter zwischen zwei und drei Jahren so anhänglich sind.
Es werden außerdem die Eingewöhnung in der Kita und Schüchternheit thematisiert, aber Substanzielles, Hilfreiches oder wirklich Konkretes findet sich leider gar nicht. "Kinder brauchen die Nähe der Eltern und die Sicherheit, dass jemand da ist" [übrigens auch bei Auszeiten ;-], "Jedes Kind muss lernen, neue Situationen zu meistern" und wenn das Kind weint, weil es nicht in die Kita will, dann soll man das akzeptieren, annehmen, selbst loslassen und mit der Kita zusammenarbeiten - wie gesagt, wenig Hilfreiches.
Auch dem Thema Phobien ist ein Unterkapitel gewidmet, das das Thema jedoch allenfalls am Rande streift und darauf verweist, sich bei Erfolglosigkeit aller Bekämpfungsmaßnahmen doch an den Kinderpsychotherapeuten zu wenden oder eine Verhaltenstherapie zu machen.
Im letzten Teil des Buches hat man ein bisschen das Gefühl, dass noch ein paar Seiten gefüllt werden mussten, denn der Bezug zur Trotzphase ist nicht so richtig nachvollziehbar, auch wenn die Überschrift lautet "Trotz beim Schlafen, Essen und Sauberwerden".
Im Teil über das Schlafen geht es darum, dass Kinder nicht über ihr persönliches Schlafbedürfnis hinaus schlafen können und feste Zeiten den Schlafrhythmus positiv beeinflussen können. Wenn man dann Tipps wie den folgenden liest, wundert man sich doch etwas:
Vielleicht bin ich ja mittlerweile betriebsblind, aber Tipps wie "das Kind kann nur schlafen, wie es seinem Schlafbedürfnis entspricht", "je älter das Kind ist, desto weniger Schlaf braucht es" und "je länger der Mittagsschlaf Ihres Kindes dauert, desto weniger schläft es nachts" würden mir persönlich wenig helfen, weil das meines Erachtens jedem völlig klar sein dürfte.
Es wird pauschal von Einschlafhilfen abgeraten, da diese das Durchschlafen erschweren und das Kind dann möglicherweise ständig ins Elternbett kommen würde. Daher wird empfohlen, das Kind alleine wach zurückzulassen. Sollte das nicht funktionieren und weint das Kind, dann wird die Tür-auf-Tür-zu-Methode empfohlen:
![Sehr ärgerliches Kind Sehr ärgerliches Kind]() Der Teil über Trotz (?) beim Essen, beginnt recht gelungen, da er den Eltern sagt: Entspannt euch und lasst die Kinder machen. Natürlich ohne Tiefe und wieder mit dem, was einigermaßen auf der Hand liegt (wenig Süßes anbieten, ausreichend Bewegung, alles immer wieder anbieten). Zum Thema Tischmanieren heißt es:
Der Teil über Trotz (?) beim Essen, beginnt recht gelungen, da er den Eltern sagt: Entspannt euch und lasst die Kinder machen. Natürlich ohne Tiefe und wieder mit dem, was einigermaßen auf der Hand liegt (wenig Süßes anbieten, ausreichend Bewegung, alles immer wieder anbieten). Zum Thema Tischmanieren heißt es:
Zum Schluss kommt noch ein kleiner Abschnitt über Trotz (?) beim Sauberwerden. Einführend wird festgestellt, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat. Daher solle kein Druck ausgeübt werden - so die Aussage, die allerdings sofort mit dem Vorschlag eines Belohnungssystems konterkariert wird. Aber damit nicht genug - es wird für Kinder, die eigentlich sauber sind, aber noch für das große Geschäft eine Windel verlangen tatsächlich auch noch Folgendes empfohlen:
Dieses Buch ist einfach nur furchtbar. Es betrachtet vollkommen normales kindliches Autonomiebestreben als Verhalten, das um jeden Preis bekämpft werden muss. Dazu müssen Eltern klare Regeln aufstellen und mit vehementer Konsequenz auf deren Einhaltung pochen. Niemals darf man nachgeben! Erdreistet sich das Kind, trotzdem wütend zu sein, wird ihm eine Auszeit verordnet - egal wofür, das hilft immer.
Das Schlimme ist: Das tut es auch! Auszeiten machen Kinder gefügig, weil sie massive Ängste schüren. Kind haben von Natur aus ein starkes Bindungsbedürfnis - daher ist für sie nichts bedrohlicher, als die Verbindung zu ihren Eltern zu verlieren oder um ihre Liebe fürchten zu müssen. Das Erziehen mit Auszeiten macht sich diese grundlegenden Ängste zunutze - Kinder werden zur Kooperation quasi gezwungen. Diese erzwungene Kooperation geht jedoch zu Lasten der Eltern-Kind-Beziehung und vor allem des Selbstwertgefühles. Auszeiten setzen Kinder massiv unter Stress, der sich langfristig auf ihr Befinden und ihr Verhalten auswirkt, so dass sie häufig später nicht als Ursache dafür erkannt werden.
Für Eltern trotzdender Kinder ist dieses Buch absolut nicht empfehlenswert - die beschriebenen Ansätze und vorgeschlagenen Methoden mögen Kinder vorübergehend gefügiger machen, dies jedoch auf eine Art und Weise, die alles andere als kindgerecht ist.
In der Autonomiephase benötigen Kinder Eltern, die verstehen, was gerade in ihnen vorgeht und die wissen, was entwicklungsbedingt normal ist. Kinder brauchen Eltern, die zugewandt in Kontakt mit ihrem Kind bleiben - egal, wie wütend alle Beteiligten sind. Es ist so außerordentlich wichtig, liebevoll auf Kinder einzugehen und ihnen Wege zeigen, wie man das vollkommen normale Gefühl der Wut regulieren und in weniger zerstörerische Bahnen leiten kann. Darüber sollte es Bücher geben - und nicht über Methoden, bei denen die Bedürfnisse von Kindern komplett ignoriert, sie entwürdigt und dann für jede Kleinigkeit wegsperrt werden! Vielleicht sollten wir einfach mal eins schreiben?
© Danielle
Im Teil über das Schlafen geht es darum, dass Kinder nicht über ihr persönliches Schlafbedürfnis hinaus schlafen können und feste Zeiten den Schlafrhythmus positiv beeinflussen können. Wenn man dann Tipps wie den folgenden liest, wundert man sich doch etwas:
"Das Bett ist zum Schlafen da! Achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht länger in seinem Bett liegt, als es tatsächlich schläft. Verbringt ihr Kind abends oder nachts ein bis zwei Stunden wach im Bett, streichen Sie diese von der Bettzeit. [...] So lernt ihr Kind, dass sein Bett zum Schlafen da ist" (S. 106)".Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber keins unserer Kinder hat morgens sehr viel länger im Bett gelegen, als es geschlafen hat. Und selbst wenn sie das getan hätten - was genau nutzt es, sie in diesem Fall schnell raus zu holen, damit sie "lernen", dass ein Bett zum Schlafen da ist? Und abends ist für mich nie wirklich kalkulierbar, wie lange das Kind zum Einschlafen braucht - das können 5 Minuten sein oder 50. Ich kann unmöglich hellsehen, dass das Kind erst in einer Stunde schlafen wird und es dann entsprechend später hinlegen.
Vielleicht bin ich ja mittlerweile betriebsblind, aber Tipps wie "das Kind kann nur schlafen, wie es seinem Schlafbedürfnis entspricht", "je älter das Kind ist, desto weniger Schlaf braucht es" und "je länger der Mittagsschlaf Ihres Kindes dauert, desto weniger schläft es nachts" würden mir persönlich wenig helfen, weil das meines Erachtens jedem völlig klar sein dürfte.
Es wird pauschal von Einschlafhilfen abgeraten, da diese das Durchschlafen erschweren und das Kind dann möglicherweise ständig ins Elternbett kommen würde. Daher wird empfohlen, das Kind alleine wach zurückzulassen. Sollte das nicht funktionieren und weint das Kind, dann wird die Tür-auf-Tür-zu-Methode empfohlen:
"Bei dieser Methode lautet die Spielregel: "Bleib in deinem Bett, dann bleibt deine Tür auf. Bleibst du nicht im Bett, mache ich die Tür zu." Nach dem Gutenachtkuss verlassen Sie das Zimmer und lassen die Tür offen. Steht Ihr Kind aus seinem Bett auf und kommt hinter Ihnen her, bringen Sie es zurück. Danach verlassen Sie sofort das Zimmer, machen die Tür zu und bleiben davor stehen. Alle ein bis zwei Minuten öffnen Sie die Tür und gehen wieder nach den Spielregeln vor - bis ihr Kind endgültig in seinem Bett bleibt und die Tür offen bleiben kann" (S. 108).
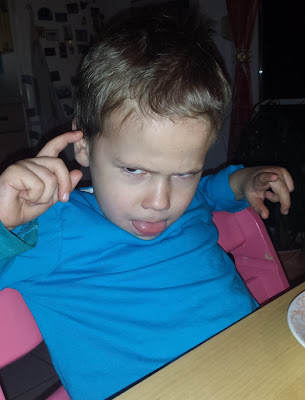 Der Teil über Trotz (?) beim Essen, beginnt recht gelungen, da er den Eltern sagt: Entspannt euch und lasst die Kinder machen. Natürlich ohne Tiefe und wieder mit dem, was einigermaßen auf der Hand liegt (wenig Süßes anbieten, ausreichend Bewegung, alles immer wieder anbieten). Zum Thema Tischmanieren heißt es:
Der Teil über Trotz (?) beim Essen, beginnt recht gelungen, da er den Eltern sagt: Entspannt euch und lasst die Kinder machen. Natürlich ohne Tiefe und wieder mit dem, was einigermaßen auf der Hand liegt (wenig Süßes anbieten, ausreichend Bewegung, alles immer wieder anbieten). Zum Thema Tischmanieren heißt es: "Nicht nur das Sitzenbleiben am Tisch gehört zum guten Benehmen, auch die Tischmanieren lernt Ihr Kind beim gemeinsamen Essen. Außerdem gelten natürlich die Regeln des freundlichen Umgangs miteinander: Den anderen ausreden lassen, selbst freundlich reden, nicht schreien. Trotz und Wutanfälle während der Mahlzeiten sollten Sie nicht zulassen. Wenn Ihr Kind bei Tisch massiv stört, etwa durch Schreien oder Quengeln, kann auch eine Auszeit angebracht sein" (S. 115).Natürlich - eine Auszeit. Andere Tipps bekommt der Leser wieder nicht.
Zum Schluss kommt noch ein kleiner Abschnitt über Trotz (?) beim Sauberwerden. Einführend wird festgestellt, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat. Daher solle kein Druck ausgeübt werden - so die Aussage, die allerdings sofort mit dem Vorschlag eines Belohnungssystems konterkariert wird. Aber damit nicht genug - es wird für Kinder, die eigentlich sauber sind, aber noch für das große Geschäft eine Windel verlangen tatsächlich auch noch Folgendes empfohlen:
"Ihr Kind braucht einen Anreiz, damit der Gang auf die Toilette attraktiver wird als die Windel. Dafür muss es für die unangenehmen Folgen der vollen Windel Verantwortung übernehmen. Lassen Sie ihr Kind alles tun, was es allein tun kann: die Windel anziehen, sie in die Toilette ausleeren, die Unterwäsche auswaschen, sich selber sauber machen" (S. 119).
Meine Meinung zum Buch
Dieses Buch ist einfach nur furchtbar. Es betrachtet vollkommen normales kindliches Autonomiebestreben als Verhalten, das um jeden Preis bekämpft werden muss. Dazu müssen Eltern klare Regeln aufstellen und mit vehementer Konsequenz auf deren Einhaltung pochen. Niemals darf man nachgeben! Erdreistet sich das Kind, trotzdem wütend zu sein, wird ihm eine Auszeit verordnet - egal wofür, das hilft immer.
Das Schlimme ist: Das tut es auch! Auszeiten machen Kinder gefügig, weil sie massive Ängste schüren. Kind haben von Natur aus ein starkes Bindungsbedürfnis - daher ist für sie nichts bedrohlicher, als die Verbindung zu ihren Eltern zu verlieren oder um ihre Liebe fürchten zu müssen. Das Erziehen mit Auszeiten macht sich diese grundlegenden Ängste zunutze - Kinder werden zur Kooperation quasi gezwungen. Diese erzwungene Kooperation geht jedoch zu Lasten der Eltern-Kind-Beziehung und vor allem des Selbstwertgefühles. Auszeiten setzen Kinder massiv unter Stress, der sich langfristig auf ihr Befinden und ihr Verhalten auswirkt, so dass sie häufig später nicht als Ursache dafür erkannt werden.
Für Eltern trotzdender Kinder ist dieses Buch absolut nicht empfehlenswert - die beschriebenen Ansätze und vorgeschlagenen Methoden mögen Kinder vorübergehend gefügiger machen, dies jedoch auf eine Art und Weise, die alles andere als kindgerecht ist.
In der Autonomiephase benötigen Kinder Eltern, die verstehen, was gerade in ihnen vorgeht und die wissen, was entwicklungsbedingt normal ist. Kinder brauchen Eltern, die zugewandt in Kontakt mit ihrem Kind bleiben - egal, wie wütend alle Beteiligten sind. Es ist so außerordentlich wichtig, liebevoll auf Kinder einzugehen und ihnen Wege zeigen, wie man das vollkommen normale Gefühl der Wut regulieren und in weniger zerstörerische Bahnen leiten kann. Darüber sollte es Bücher geben - und nicht über Methoden, bei denen die Bedürfnisse von Kindern komplett ignoriert, sie entwürdigt und dann für jede Kleinigkeit wegsperrt werden! Vielleicht sollten wir einfach mal eins schreiben?
© Danielle